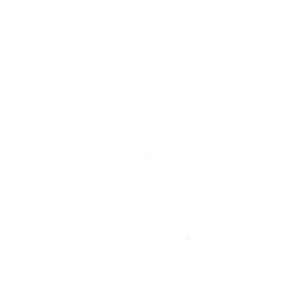Anzeige: Hufrehe gehört zu den größten Sorgen von Pferdehaltern. Die Entzündung der Huflederhaut ist für Pferde extrem schmerzhaft und erfordert sofortiges Handeln. Wichtig ist nicht nur die Behandlung, sondern auch die Vorbeugung – etwa durch Kontrolle des niedriger Fruktangehalt im Gras. Warum das so entscheidend ist und wie du Hufrehe vermeiden kannst, erfährst du hier.
Was ist Hufrehe beim Pferd?
Unter Hufrehe versteht man eine Erkrankung, bei der die Huflederhaut des Pferdes betroffen ist, genauer genommen die Lederhautblättchen. Diese befinden sich in der Zehenwand und verbinden das Hufhorn mit der Lederhaut. Die Krankheit äußert sich als eine diffuse, aseptische Entzündung. Darunter versteht man einen Entzündungsprozess, der nicht von einem Keim ausgelöst wird, sondern seine Ursache woanders hat.
Häufig sind veränderte Stoffwechselprozesse des Pferdes Schuld an dem Ausbruch der Erkrankung. Störungen des Hormonhaushalts, falsche Fütterungsbedingungen oder Vergiftungen können ursächlich sein. Hufrehe können zu einer Veränderung der Hufposition führen, vor allem wenn sie unbehandelt bleiben. Die Erkrankung ist für das Pferd äußert schmerzhaft und sollte daher schnellstmöglich erkannt und behandelt werden. Üblicherweise sind nur die Vorderhufe betroffen, in schlimmen Fällen können jedoch alle vier Hufe erkrankt sein.
Bestehen die Rehe länger als 48 Stunden, werden sie als chronisch angesehen. Folgen können ein Absenken des Hufbeines sein, wie auch eine Veränderung der Hufgelenkhaltung. Meist kommt es zu einer Rotation im Gelenk, wodurch sich die Hufbeinspitze Richtung Boden senkt und kein paralleles Vorliegen von Sohlen- und Hufbein mehr garantiert ist. Das Worst-Case-Scenario wäre ein Bruch der Sohle oder das sogenannte „Hausschuhen“.

Typische Hufverformung bei chronischer Hufrehe: Deutlich sichtbar sind die abgesenkten Trachten, die Wölbung der Hufsohle und die divergierenden Hornringe.
Was sind die Ursachen und Auslöser von Hufrehe beim Pferd?
Hufrehe ist eine entzündliche Erkrankung der Huflederhaut, deren Ursachen meist in einer gestörten Stoffwechsellage oder in der Fütterung liegen. Dabei kommt es zu einer Unterversorgung des Gewebes mit Sauerstoff – oft mit schwerwiegenden Folgen für das Pferd.
Eine der häufigsten Ursachen ist die sogenannte Futterrehe. Sie entsteht durch eine falsche Fütterung – insbesondere durch eine übermäßige Aufnahme von Fruktanen, einem Zucker, der in vielen Grasarten vorkommt. Pferde können Fruktane nur begrenzt verdauen. Werden zu große Mengen aufgenommen, führt das zu einer Störung der Verdauung, bei der Giftstoffe entstehen und in den Blutkreislauf gelangen. Dort lösen sie Entzündungen in der Huflederhaut aus.

Um Hufrehe beim Pferd vorzubeugen ist es wichtig, die Pferde Gras mit geringem Fruktangehalt fressen zu lassen. Wir empfehlen Dir das Pferdegras von Barenbrug.
Besonders gefährlich: Frisches Weidegras mit hohem Fruktangehalt – zum Beispiel im Frühling oder bei Stress im Pflanzenwachstum. Deshalb ist es essenziell, auf grasarten mit niedrigem Fruktangehalt zu achten. Unsere Empfehlung: das speziell entwickelte Pferdegras von Barenbrug – später mehr dazu.
Auch Stoffwechselerkrankungen wie das Equine Cushing Syndrom (ECS) oder das Equine Metabolische Syndrom (EMS) gelten als bedeutende Risikofaktoren. Beide gehen mit einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel einher – besonders bei übergewichtigen Pferden mit Insulinresistenz. Das erhöht die Anfälligkeit für Fütterungsrehe deutlich.
Darüber hinaus können auch andere Auslöser eine Rolle spielen – darunter Belastung, Vergiftung, Medikamente oder Geburt. Diese werden im folgenden Abschnitt zu den Arten von Hufrehe genauer erläutert.
Auch orthopädische Probleme oder fehlerhafte Hufbearbeitung können zur Entstehung von Hufrehe beitragen, indem sie die Belastung im Huf ungleichmäßig verteilen.
Die häufigsten Ursachen für Hufrehe im Überblick:
Falsche Fütterung / Fruktan-Überlastung (Futterrehe)
Stoffwechselerkrankungen (ECS, EMS, Insulinresistenz)
Übergewicht und Bewegungsmangel
Fehlerhafte Hufbearbeitung oder orthopädische Fehlstellungen
Weitere Auslöser: Belastung, Vergiftung, Medikamente, Geburt (mehr dazu im nächsten Abschnitt)
Wichtig: Meist wirken mehrere Ursachen zusammen. Deshalb sollte immer eine ganzheitliche Betrachtung des Pferdes erfolgen – insbesondere zur Prävention.
Ist Hufrehe heilbar?
Die Prognose wird meist vorsichtig gestellt. Ob Hufrehe heilbar sind, wird meist an der Winkelveränderung durch die Hufbeinrotation im Zuge einer Rötgnebildanalyse beurteilt. Eine einmal auftretende akute Rehe ist heilbar.
Welche Symptome deuten frühzeitig auf Hufrehe hin?
Hufrehe zählt zu den schmerzhaftesten und gefährlichsten Erkrankungen beim Pferd. Sie entsteht meist schleichend – und doch entscheidet die frühe Erkennung über den Verlauf. Erste Symptome zeigen sich oft subtil: Die betroffene Hufe fühlt sich wärmer an als gewöhnlich, und am sogenannten Kronrand – dem oberen Rand der Hufkapsel – kann es zu leichten Schwellungen kommen. Gleichzeitig verändert sich das Gangbild: Pferde mit beginnender Hufrehe bewegen sich vorsichtiger, steifer und gebremster. Manche zeigen erste Anzeichen von Lahmheit oder eine deutliche Schonhaltung, indem sie versuchen, das Gewicht auf die gesunden Gliedmaßen zu verlagern.

Es gibt verschiedene Formen von Hufrehe, die Futterrehe tritt dabei am häufigsten auf und entsteht oft durch eine falsche Ernährung.
Auch ein stark pulsierendes Gefühl an den Blutgefäßen im Bereich des Fesselkopfes kann auf eine akute Entzündung der Huflederhaut hinweisen. In dieser Phase ist schnelle Hilfe entscheidend: Je früher Hufrehe diagnostiziert wird, desto größer ist die Chance, den Verlauf aufzuhalten.
Hier findest Du noch einmal alle Symptome zum jeweiligen Stadium der Hufrehe auf einen Blick:
| Stadium der Hufrehe | Symptome |
|---|---|
| Prodromalstadium (Anfangsstadium) | – Unruhe |
| – Widerwillen beim Hufeauskratzen | |
| – Vermehrtes Aufheben der Hufe | |
| – Keine offensichtlichen Gangbildveränderungen | |
| Akutes Stadium | – Veränderung der Körperhaltung |
| – Klammernder Gang, mögliche Lahmheit | |
| – Wendeschmerzen | |
| – Verstärktes Pulsieren der Digitalarterien | |
| – Schwellung des Kronsaums | |
| – Erhöhte Temperatur der Hornkapsel | |
| – Druckempfindlichkeit bei Berührung oder Abklopfen des Hufes | |
| – Trachtenfußung (Belastung der Hufe auf den Trachten) | |
| Chronisches Stadium | – Verlagerung des Hufbeins (sichtbar auf Röntgenbildern) |
| – Rotation oder Senkung des Hufbeins | |
| – Aufhellung im Hufbeinträger | |
| – Deformierungen des Hufbeinrandes | |
| – Divergierende Hornringe | |
| – Verbreiterte, weiße Linie | |
| – Vorwölbung der Hufsohle | |
| – Eingesunkene Krone | |
| Mögliche Komplikationen | |
| – Hufabszess | |
| – Nekrose des Hufbeins | |
| – Durchbruch des Hufbeins durch die Hufsohle | |
| – Ausschuhen (Abstoßen der Hufkapsel) |
Welches Mineralfutter bei Hufrehe?
Bei der Auswahl von Mineralfutter sollte unbedingt tierärztlicher Rat befolgt werden. Je nachdem, ob das Pferd Mangelerscheinungen aufweist, sollten Zusätze gefüttert werden. Vielen Pferden hilft Bierhefe ohne Treber.
Wie ist der Krankheitsverlauf bei Hufrehe?
Hufrehe verläuft typischerweise in drei Phasen: vom kaum wahrnehmbaren Vorstadium über das akute Stadium bis hin zur chronischen, strukturell veränderten Rehe. Der Krankheitsverlauf ist individuell – aber immer ernst zu nehmen.
Prodromalstadium – Die leisen Vorboten
Im Vorstadium sind die Symptome oft unspezifisch und leicht zu übersehen. Pferde zeigen sich unruhig, verhalten sich widerwillig beim Hufeauskratzen oder lehnen sich beim Hufeaufheben gegen den Menschen. Besonders bei Ponys bleiben Schmerzen in dieser Phase oft unbemerkt, da sie deutlich weniger Schmerzverhalten zeigen als Großpferde. Eine Veränderung im Gangbild ist in diesem frühen Stadium meist noch nicht erkennbar – was die Diagnose erschwert.
Akutes Stadium – Wenn Hufrehe sichtbar wird
Im akuten Stadium treten die klinisch sichtbaren Symptome klar hervor: Die Pferde entwickeln einen klammernden, steifen Gang, Lahmheit ist häufig. Die Körperhaltung verändert sich deutlich – viele Tiere entlasten die betroffenen Hufe und zeigen Wendeschmerzen, vor allem auf hartem Boden oder beim Drehen. Typisch ist eine verstärkte Pulsation der Digitalarterien, eine Schwellung des Kronsaums sowie eine spürbar erhöhte Temperatur der Hornkapsel. Auch eine Druckempfindlichkeit bei Berührungen des Hufes oder beim Abklopfen ist häufig. Manche Pferde zeigen zusätzlich eine Trachtenfußung – also eine deutlich veränderte Art der Hufbelastung.
Chronisches Stadium – Wenn es zu Spätfolgen kommt
Wird die akute Rehe nicht innerhalb von 48 Stunden behandelt, kann sie in die chronische Phase übergehen. Jetzt treten bleibende strukturelle Veränderungen auf – das Hufbein verändert seine Position innerhalb der Hufkapsel, was starke Schmerzen verursacht. Im Röntgenbild lässt sich häufig eine Rotation oder Senkung des Hufbeins erkennen. Auch eine Aufhellung im Bereich des Hufbeinträgers, deformierte Hufbeinränder und sogenannte divergierende Hornringe zählen zu den typischen Anzeichen.
Von außen sichtbar sind oft eine verbreiterte, weiße Linie, eine nach vorn gewölbte Hufsohle oder sogar eine eingesunkene Krone. Ohne gezielte Therapie kann es zu schweren Komplikationen kommen – darunter Hufabszesse, Nekrosen, ein Durchbruch des Hufbeins durch die Sohle oder im schlimmsten Fall das sogenannte Ausschuhen, bei dem sich die Hufkapsel vom Hufbein ablöst.
Welche Arten von Hufrehe gibt es?
Neben der Futterrehe gibt es weitere Formen von Rehen und Ursachen, die wir dir in der folgenden Tabelle übersichtlich zusammegestellt haben:
| Art der Rehe | Ursachen |
|---|---|
| Futterrehe | – Falsche Fütterung |
| – Stoffwechselerkrankungen | |
| – Freisetzung von Giftstoffen | |
| – Entzündungsprozesse und Enzymreaktionen in der Huflederhaut | |
| Belastungsrehe | – Überbelastung des Hufes |
| – Ungeeignete Untergründe | |
| – Zu lange Stallphasen | |
| – Übermäßiges Training | |
| Vergiftungsrehe | – Aufnahme von Giftpflanzen (z.B. Robinien, Eicheln, Rizinus) |
| – Pestizide und Fungizide | |
| – Schimmelpilze | |
| Medikamentenrehe | – Verwendung von Cortison-Präparaten |
| Traumatische Rehe | – Zerrungen, Zerreißungen, Quetschungen der Huflederhaut |
| Geburtsrehe | – Nachgeburt-Überreste in der Gebärmutter |
| – Bakterielle Zersetzung und Beeinträchtigung des Blutkreislaufs | |
| Stoffwechselstörungen | – Equines Cushing Syndrom (ECS): Hoher Cortisolspiegel, unkontrollierter Blutzuckerspiegel |
| – Equines Metabolisches Syndrom (EMS): Übergewicht, Insulinresistenz | |
| Fehler bei der Hufarbeit oder Beschlagsfehler | – Fehlerhafte Hufbearbeitung oder -beschlag |
| Orthopädische Probleme | – Anormale Hufform |
Kann man ein Pferd reiten, wenn es Hufrehe hat?
Ob ein Pferd bei Erkrankung an einer Hufrehe geritten werden kann, ist von Pferd zu Pferd unterschiedlich und sollte mit dem behandelnden Tierarzt abgeklärt werden.
Hufrehe beim Pferd: Maßnahmen zur Selbsthilfe
An erster Stelle bei Entdeckung von möglichen Hufrehen steht schnelles Handeln. Es sollte umgehend der Tierarzt des Vertrauens konsultiert werden, damit eine richtige Diagnose gestellt werden kann. Eine Maßnahme, die sofort ergriffen werden kann, ist das Kühlen des Hufbeins. Am besten wird hier am Röhrbein gekühlt und nicht am Huf des Pferdes, da die Hornsubstanz isolierend wirkt. Es sollte möglichst ohne Unterbrechung gekühlt werden, idealerweise in einem Bereich zwischen 0 und 0,5 Grad Celsius. Verwendet werden sollte ausschließlich Eiswasser in hohen Behältnissen, sogenannte Kryotherapiestiefel. Kühlmanschetten sind nicht geeignet, da diese meist keine ausreichende Kühlung verursachen und sogar negative Auswirkungen haben können. Sporadisches Kühlen mit Unterbrechungen bringen keinen positiven Effekt, sondern wirkt im Gegenteil sogar durchblutungsfördernd.
Sind Futterhufrehe bekannt, sollte sofort das Futter umgestellt werden. Wichtig ist außerdem eine Entlastung des Hufes. Das Pferd sollte nicht auf hartem Untergrund stehen, sondern möglichst weich und gepolstert stehen. Das Pferd sollte außerdem, bis eine Abklärung mit dem Tierarzt erfolgt ist, auf keinen Fall geritten werden.

Es gibt verschiedene Maßnahmen, um ein Ausbrechen der Erkrankung zu verhindern. Dabei nimmt das richtige Futtermanagement eine entscheidende Rolle ein.
Erste Hilfe bei Hufrehe – Was du sofort tun solltest
Bei Verdacht auf Hufrehe zählt jede Minute. Sofortmaßnahmen können die Situation entscheidend verbessern:
Tierarzt rufen: Für eine schnelle Diagnose per Abtasten, Bluttest oder Röntgenbild
Kühlung: Hufe mit Wasser oder Eis herunterkühlen, um Entzündung zu bremsen
Weidegang beenden: Sofort runter von der Koppel
Futter umstellen: Nur Heu, Stroh und Mineralfutter – kein frisches Gras oder Kraftfutter
Weich stellen: Hufe entlasten durch Späne, Sand, Moosgummi oder Polsterverbände
Hufrehe & Futter: Warum Kuhgras gefährlich ist – und was du stattdessen säen solltest
Die richtige Fütterung ist entscheidend, um den Genesungsverlauf zu unterstützen. Liegt eine Hufrehe beim Pferd vor, sollten ausschließlich Heu, Mineralfutter, Kräuter und Stroh in geringen Maßen gefüttert werden. Die Menge richtet sich wie bei der normalen Fütterung nach dem Energieverbrauch des Tieres und sollte daran bemessen werden. Nicht gefüttert werden sollten Küchen- und Gartenabfälle, stark zuckerhaltige Futtermittel, sowie leicht verdauliche Kohlenhydrate. Dazu zählen beispielsweise Getreide und Mais.
Außerdem sollte, wie bereits beschrieben, fruktanhaltiges Gras vermieden werden. Es gibt spezielles Pferdegras, wie das von Barenbrug, welches auf die Bedürfnisse der Pferde abgestimmt ist. Die meisten Pferde grasen normalerweise auf Kuhweiden und erhalten auch Heu oder Silage von diesen Weiden. Obwohl dieses Gras für Pferde sehr schmackhaft ist, ist es jedoch häufig zu energiereich aufgrund des hohen Fruktangehalts und enthält zu wenig Struktur. Eine solche Ernährung kann zu gesundheitlichen Problemen bei den Pferden führen, wobei Hufrehe und Kreuzverschlag häufig auftreten können. Um die Gesundheit Deiner Pferde zu gewährleisten, ist es daher wichtig, dass sie Zugang zu geeignetem Pferdegras haben.
Wir empfehlen Dir das Pferdegras Horse Master® von Barenbrug, welches eine ausgewogene Grassamenmischung beinhaltet. Eine Horse Master®-Weide hat eine robuste Grasnarbe, einen schnellen Nachwuchs und die Pflanzen sind strukturreich und fruktanarm.
Dein Pferd neigt zu Hufrehe und Du möchtest auf Deiner Weide unbedingt spezielles Pferdegras haben? Dann schau direkt bei dem Sortiment von Barenbrug vorbei!
Das Gras bietet Dir hochwertiges Futter für Heu und Silage. Es ist frisch, schmackhaft und perfekt für Pferde geeignet. Mit einer hohen Grundfutterproduktion und hervorragender Trockentoleranz erhältst Du erstklassiges Heu. Im Vergleich zum Naturheu bietet das Hay Master® zusätzliche Masse dank des enthaltenen Klees. Darüber hinaus profitierst Du von der NutriFibre®-Technologie, die eine optimale Nährstoffversorgung sicherstellt.
Entdecke Horse Master® von Barenbrug. Mit ausreichendem, schmackhaftem Gras und der innovativen RPR-Technologie bietet es eine starke Grasnarbe, fördert das Nachwachsen und reduziert das Risiko von Sandkoliken und Hufrehe. Auch Schafe, Esel und Alpakas können von dieser hochwertigen Weide profitieren.
Du möchtest noch mehr zu den einzelnen Besonderheiten der beiden Produkte erfahren? Dann schau unbedingt bei Barenbrug vorbei! → Mehr erfahren
Expertenwissen von Barenbrug: Wie gezielte Weidepflege das Risiko für Hufrehe senkt
Die richtige Fütterung beginnt auf der Weide – und kann entscheidend dazu beitragen, Hufrehe zu vermeiden. Auf Barenbrug-zertifizierten Betrieben wird deutlich: Wer sein Grünland gezielt pflegt, schützt seine Pferde aktiv vor gesundheitlichen Risiken.
Ein zentrales Element ist die kontrollierte Nutzung fruktanarmer Grasarten. Pferde grasen bevorzugt auf kurzen, strukturreichen Beständen – das senkt die Zuckerkonzentration und reduziert damit die Gefahr von Fütterungsrehe.
Auch die ganzjährige Weidehaltung spielt eine Rolle: Dank sandigem Boden und guter Entwässerung bleiben die Flächen selbst bei Nässe begehbar, ohne die Grasnarbe zu beschädigen.
Mit der Horse Master®-Nachsaat bleibt die Weide dicht, vital und belastbar – und verdrängt gleichzeitig unerwünschte Pflanzen wie Jakobskreuzkraut. Ergänzend sorgen Tasty Herbs, eine speziell entwickelte Kräutermischung, für eine bessere Futteraufnahme, stabilere Böden und eine natürliche Versorgung mit Mikronährstoffen.
Für die Heugewinnung setzen viele Betriebe auf Hay Master® – eine Mischung mit tiefwurzelndem Rohrschwingel, die nicht nur ertragreich, sondern auch besonders trockenheitstolerant ist.
Mit der richtigen Grasstrategie legst du den Grundstein für gesunde Hufe und eine stabile Verdauung – ganz ohne Futterstress.
Du möchtest noch mehr zum Thema Qualität der Pferdeweide erfahren? Dann schaue unbedingt bei dem Barenbrug Ratgeber vorbei!
Lange Weidegänge sind für Pferde mit einem aktuen Hufrehbefall vorerst nicht annehmbar. Es ist außerdem sehr wichtig, dass keine ansäuernden Futtermittel gefüttert werden. Darunter versteht man beispielsweise Silage und Ähnliches.
Wie kann ich Hufrehe beim Pferd vorbeugen?
Um Hufrehen vorzubeugen, spielen besonders die Haltung und Fütterung eine essenzielle Rolle. Dies gilt insbesondere für Pferde, die noch nie von der Erkrankung betroffen waren. Regelmäßiger Weidegang ist für Pferde wichtig, doch auf die richtigen Zeiten wie auch die Weidepflege kommt es an. Sorge deshalb für eine Weide mit gesundem Pferdegras, mit hoher Trittfestigkeit und Grasnarbendichte.
Außerdem sollte unbedingt Übergewicht vermieden werden, damit es zu keinen Stoffwechselstörungen, wie einer Insulinresistenz, kommen kann. Die artgerechte Fütterung ist vor allem für Pferde wichtig, die empfindlich auf Futterumstellungen und -inhaltstoffe reagieren. Natürlich sollte im Zuge der Prophylaxe von Hufrehen auch auf eine gute Hufpflege geachtet werden. Die Hufe sollen weder zu trocken, noch zu feucht sein, und hin und wieder geölt werden. Auch der Hufschmied sollte regelmäßig einen Blick auf die Hufe werfen. Um insgesamt zur Gesundheit des Pferdes beizutragen, können Entgiftungs- und Stoffwechselkuren durchgeführt werden.
Für Pferde, die zuvor bereits mit Hufrehen konfrontiert waren, gilt eine besondere Achtsamkeit. Schäden, die durch vorangegangene Erkrankungen entstanden sind, können leider nicht rückgängig gemacht werden, deshalb ist es umso wichtiger, die Hufgesundheit zu erhalten. Das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, erneute Hufreh-Schübe zu vermeiden und einem chronischen Verlauf vorzubeugen.

Häufig grasen Pferde auf Kuhweiden, welche Gras mit einem zu hohen Fruktangehalt beinhalten. Dies kann Hufrehe beim Pferd begünstigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Dein Pferd auf Pferdegras, wie das von Barenbrug, weidet.
Wann ist eine Hufrehe geheilt?
Eine Hufrehe gilt als geheilt, wenn das Pferd keine Entzündung der Huflederhaut mehr aufweist und schmerzfrei ist. Bei Veränderungen im Huf muss sich dieser noch erholen.
Handlungsempfehlung bei Hufrehe – So schützt du dein Pferd
Hufrehe ist ein medizinischer Notfall – deshalb gilt: Reagiere sofort, nicht später. Schon bei ersten Anzeichen solltest Du unverzüglich den Tierarzt verständigen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Kühlung, Futterumstellung und Schonung können entscheidend sein, um Schmerzen zu lindern und Spätfolgen zu verhindern.
Doch nicht nur die Behandlung ist wichtig – sondern vor allem die Ursachenbekämpfung. Um Rückfälle zu vermeiden, ist es essenziell, den Auslöser der Rehe genau zu identifizieren. In vielen Fällen spielt dabei die Ernährung eine zentrale Rolle: Achte auf einen niedrigen Fruktangehalt im Gras, kontrolliere die Fütterung genau und beuge Stoffwechselerkrankungen aktiv vor.
Unser Tipp: Fruktanarmes Pferdegras, wie das Spezialgras von Barenbrug, kann helfen, das Risiko deutlich zu senken – gerade bei empfindlichen oder vorbelasteten Pferden.
Hufrehe: Krankheitssteckbrief
- Symptome: Huf ist warm, Lahmheit, Pulsieren am Fesselkopf
- Verlauf: akut und chronisch
- Schwere der Erkrankung: kommt auf den Krankheitsverlauf an
- Häufigkeit: Gelegentlich
- Vorkommen: Bei allen Pferden
- Diagnose: Abtasten der Hufe, Blutuntersuchung, Röntgenbilder
- Behandlung: Umstellung der Fütterung, Kühlung des Hufbeins
- Prognose: Abhängig von Schwere und Stadium der Erkrankung
- Ansteckungsgefahr: Nicht ansteckend
- Fachgebiet: Orthopädie